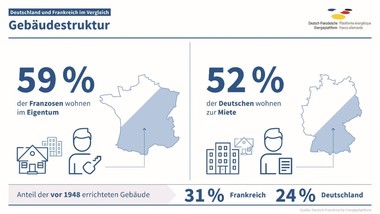Von der Pflicht zur Chance: Der Fahrplan für grüne Gebäude
Der Gebäudesektor steht vor einer doppelten Herausforderung: Es soll bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden unter gleichzeitiger Verantwortung für den Klimaschutz. Beide Ziele sind richtig, doch scheinen sie sich in der Praxis zunehmend zu widersprechen.
Der Gebäudesektor hat 2024 zum dritten Mal in Folge seine Klimaziele verfehlt. Gleichzeitig wurden zentrale Förderprogramme wie die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) in Teilen ausgesetzt oder gekürzt. Die geplante Einführung der kommunalen Wärmeplanung, die Novelle des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) mit dem verpflichtenden Einbau von 65 %-EE-Heizungen, sowie verschärfte Anforderungen durch die EU-Gebäuderichtlinie (EPBD) setzen die Branche weiter unter Druck. Zugleich bleibt die konkrete Ausgestaltung vieler dieser Regelungen unklar.
Unternehmen müssen heute strategische Entscheidungen treffen, während sich die politischen Leitplanken kontinuierlich verschieben. Die zentrale Frage lautet daher: Sind grüne Gebäude unter diesen Bedingungen überhaupt noch möglich?
Bestandsaufnahme: Was erreicht wurde und was zu tun bleibt
Trotz schwieriger Rahmenbedingungen sind in den vergangenen Jahren wichtige Fortschritte erzielt worden. Nachhaltigkeit ist in der Breite der Wohnungswirtschaft angekommen. Die EU-Taxonomie und ESG-Kriterien werden zunehmend als Steuerungsinstrumente für Investitionsentscheidungen genutzt. Auch der Lebenszyklusansatz in der Planung hat sich etabliert. Pilotprojekte und Bauvorhaben bei großen Trägern veranschaulichen die Umsetzbarkeit.
Ein Beispiel für ein zirkuläres, modulares Gebäudesystem ist das Projekt ADPT. Das entstandene Gebäude ist vollständig rückbaubar, wiederverwendbar und an veränderte Nutzungsanforderungen anpassbar. Der erste Prototyp wurde 2022 in Essen als begehbarer Pavillon umgesetzt.
Politische Rahmenbedingungen: Orientierung oder Verunsicherung?
Die aktuellen politischen Vorgaben führen eher zu Unsicherheit als zu Klarheit. Hier einige zentrale Punkte:
– Gebäudeenergiegesetz (GEG): Seit 2024 müssen alle neu eingebauten Heizungen zu mindestens 65 % mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Die kommunale Wärmeplanung soll dabei Leitplanken setzen, ist aber vielerorts noch nicht vorhanden. Für Wohnungsunternehmen bedeutet das: Unsicherheit bei der Planung langfristiger Sanierungsstrategien.
– BEG-Förderung: Die Kürzungen im Effizienzhausstandard sowie bei Einzelmaßnahmen führen zu sinkender Wirtschaftlichkeit, insbesondere bei komplexen Sanierungsvorhaben. Die aktuell geltenden Bedingungen erschweren eine strategische Investitionsplanung.
– EU-Gebäuderichtlinie (EPBD): Sie fordert die Sanierung der am wenigsten nachhaltigen 15 % der Gebäude bis 2030 (Stufe G nach Energieausweis). Die Umsetzung in nationales Recht ist noch offen, wird aber gravierende Auswirkungen auf Wohnungsportfolios haben.
– Steuerliche Rahmenbedingungen: Die lineare Abschreibung (AfA) bleibt für viele Investoren unattraktiv, trotz temporärer Sonderabschreibungen. Gleichzeitig steigen CO₂-Preise im Emissionshandel.
Diese Gemengelage erschwert die Projektentwicklung und die Kommunikation mit Mieterschaft, Investoren sowie kommunalen Partnern gleichermaßen. Viele Entscheider in der Wohnungswirtschaft erleben einen Spagat zwischen regulatorischer Überforderung und politischer Erwartungshaltung.
Fünf Stellschrauben für Wohnungsunternehmen: Strategisch handeln trotz Unsicherheit
Wie lässt sich also unter diesen Bedingungen planen, bauen und sanieren?
1. Strategie & Bilanzierung: Transparenz als Grundlage
Nachhaltigkeit muss planbar sein. Das beginnt mit einer belastbaren Datengrundlage: CO₂-Bilanzen, Lebenszykluskosten, Portfolioanalysen. Unterstützen können Szenarienmodelle, die ökologische und ökonomische Faktoren integrieren. Entscheidend ist: Welche Maßnahmen haben kurz-, mittel- und langfristig die größte Wirkung im Bestand? Welche Gebäude sollten priorisiert saniert werden?
Ein standardisiertes ESG-Scoring kann Investitionen strategisch steuern und hilft auch bei der Kommunikation gegenüber Kapitalgebern und Aufsichtsgremien.
2. Bestand als Klimaschatz: Sanierung modular denken
Die große Transformation wird nicht im Neubau entschieden. Rund 80 % des Gebäudebestands von 2045 steht bereits heute. Daher ist der Bestand der entscheidende Hebel. Statt Komplettsanierung in einem Schritt sind modulare Sanierungskonzepte zu empfehlen.
3. Low-Tech, High-Impact: Technisch einfach, wirkungsvoll umgesetzt
In Zeiten knapper Budgets braucht es robuste, wartungsarme Lösungen: Es gilt auf bewährte Technologien zu setzen, deren Wirkung nachgewiesen ist. Beispiele:
– Natürliche Lüftungskonzepte statt komplexer RLT-Anlagen
– PV-Anlagen mit Direktverbrauch
– Digitale Mess- und Steuertechnik zur Betriebsoptimierung
Diese Systeme sind skalierbar und reduzieren langfristig Betriebskosten. In vielen Projekten werden schon mit Low-Tech-Konzepten eine hohe Energieeffizienz bei maximaler Nutzerakzeptanz erreicht.
4. Zirkuläres Bauen: Materialien als Ressource denken
Gebäude sind Rohstofflager. Zirkuläres Bauen bedeutet, Konstruktionen von Beginn an rückbaubar und wiederverwendbar zu gestalten. Tools wie Materialpässe, digitale Zwillinge und Bauteilkataster ermöglichen Transparenz über Lebenszyklen.
5. Kooperation & Projektvorbereitung: Gemeinsam planen, schneller umsetzen
In einem volatilen Förderumfeld lohnt sich vorbereitendes Planen. Wohnungsunternehmen sollten frühzeitig Konzepte erstellen, die auf verschiedene Finanzierungs- und Förderszenarien angepasst werden können. So können Projekte starten, sobald Mittel verfügbar sind.
Zugleich braucht es neue Formen der Zusammenarbeit: Mit Energieversorgern für Quartierswärme, mit Kommunen für Infrastruktur, mit Tech-Startups für Monitoring und Steuerung.
Fazit: Jetzt Verantwortung übernehmen – mit dem, was wir haben
Die Bedingungen für nachhaltiges Bauen und Sanieren sind herausfordernd. Doch wir können nicht auf bessere Zeiten warten. Wir müssen mit den Rahmenbedingungen arbeiten, die uns zur Verfügung stehen. Dabei stehen Entscheider der Branche selbst in der Verantwortung, Lösungen zu finden, zu skalieren und umzusetzen.
Wer heute gezielt investiert, schafft nicht nur Wohnraum, sondern auch Resilienz, Energieunabhängigkeit und Zukunftssicherheit. 2030 ist nicht mehr weit. Aber es ist erreichbar, wenn wir jetzt handeln.