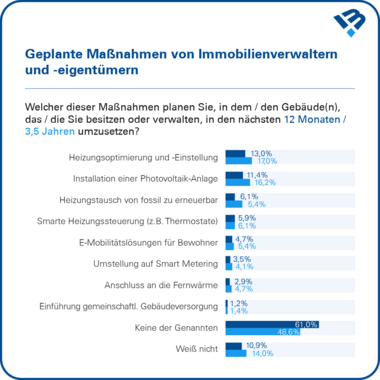Baustelle Gebäudesektor
Der Gebäudesektor ist eine der größten Baustellen beim Klimaschutz – und gleichzeitig der mit dem größten Anteil am Gesamtenergieverbrauch Deutschlands. Doch es gibt Wege, mit denen Projektträger, Immobilienverwalter und -eigentümer zum Erreichen der Klimaziele beitragen und gleichzeitig ihre Immobilie aufwerten können.
Bisher lag der Schwerpunkt in der Wohnungswirtschaft vorrangig darauf, die Energieeffizienz von Gebäuden zu erhöhen, etwa durch Dämmen, Heizungsmodernisierungen oder den Austausch von Fenstern. Und dies hat bereits Wirkung gezeigt. Zum Beispiel ist der flächenspezifische Heizenergiebedarf von Mehrfamilienhäusern durch solche energetischen Modernisierungen und durch den Neubau energieeffizienter Gebäude innerhalb von zehn Jahren um etwa 16 % gesunken[1]. Der Anteil der Mietwohnungen in den schlechtesten Energieeffizienzklassen „G“ und „H“ hat sich zwischen 2017 und 2020 um rund 25 % reduziert, während er in den Klassen „A+“ bis „B“ um rund 21 % zunahm[2].
Im Einzelfall sind die Auswirkungen von technischen Effizienzmaßnahmen besonders groß, wenn diese individuell auf die Immobilie abgestimmt sind, wie das im Rahmen einer Energieberatung geschieht. Ein interdisziplinärer Ansatz, der neueste Technologien und Lösungen für das gesamte Gebäude integriert, trägt außerdem zu maximaler Effizienz bei.
„Der Fokus auf die Effizienzsteigerung reicht jedoch nicht aus, um die Klimaziele für den Gebäudesektor zu erreichen“, erklärt Sebastian Stalf, Consultant Energieeffizienz Gebäude bei BFE Institut für Energie und Umwelt. „Es muss auch die Dekarbonisierung in den Blick genommen werden. Davon profitieren nicht nur die Umwelt, sondern auch Projektentwickler, Immobilienverwalter und -eigentümer.“
Gewinn fürs Klima und für Projektentwickler, Immobilienverwalter und -eigentümer
Die Vorteile: Wohnimmobilien enden nicht als „stranded asset“, sondern ihr Wert bleibt langfristig erhalten bzw. wird gesteigert. Die Betriebskosten bleiben auch auf längere Sicht minimal und planbar. „Was sonst vor dem Hintergrund steigender CO2-Preise nicht der Fall sein wird“, ergänzt Sebastian Stalf. „2027 startet der neue EU-Emissionshandel. Fachleute gehen davon aus, dass der CO2-Preis von aktuell 55 Euro pro Tonne CO2e auf 70 bis 300 Euro pro Tonne CO2e im Jahr 2030 steigen wird. Nimmt man einen mittleren Wert von 150 Euro, lägen die Mehrkosten für Heizöl bei +2,53 Cent pro kWh, für Erdgas bei +1,9 Cent pro kWh.“
Für eine 100-Quadratmeter-Wohnung im Mehrfamilienhaus mit durchschnittlichem Gasverbrauch bedeutet das Mehrkosten von rund 270 Euro pro Jahr allein durch den CO2-Preis. Diese lassen sich durch eine abgestimmte Dekarbonisierungsstrategie deutlich reduzieren oder ganz vermeiden – was die Attraktivität der Immobilie erhöht. Das ist nicht nur für Immobilienkäufer und Mieter wichtig, sondern auch für Investoren und andere Stakeholder.
Fundament für die Dekarbonisierung
„Wer über Maßnahmen nachdenkt, um den CO2-Fußabdruck seiner Immobilien zu verkleinern, sollte – wie beim Bauen – mit einem soliden Fundament beginnen“, empfiehlt Sebastian Stalf. „Denn nur so lässt sich sicherstellen, dass Maßnahmen optimal auf die Immobilie und ihre Nutzer abgestimmt sind, aber auch aufeinander, auf die Zielsetzung und externe Faktoren. Hierfür haben wir das Dekarbonisierungsaudit entwickelt.“
Beim Dekarbonisierungsaudit werden die CO2-Emissionen eines Gebäudes während seines gesamten Lebenszyklus betrachtet und neben der Immobilie selbst auch dessen Bewohner und das Umfeld mit einbezogen. Ein solches Audit umfasst:
• die Definition konkreter Ziele mit Zeitplan,
• die Ermittlung der aktuellen gebäudespezifischen Emissionsbilanz,
• eine Bewertung der energetischen Ausgangssituation,
• die Entwicklung und Berechnung von Maßnahmen mit Prioritäten und Zeitachsen,
• Wirtschaftlichkeitsanalysen inkl. Investitionsbedarf und Amortisation.
„Dabei werden auch technische, finanzielle und regulatorische Rahmenbedingungen sowie Förderoptionen berücksichtigt“, fügt Sebastian Stalf hinzu. Anhand der Ergebnisse des Audits wird außerdem klar erkennbar, ob die Immobilie die aktuellen und geplanten gesetzlichen Anforderungen erfüllt oder wo Handlungsbedarf besteht.
Ein Praxisbeispiel
Wie ein solches Audit konkret aussehen kann, zeigt ein fiktives, aber realitätsnahes Beispiel: Ein kommunales Wohnungsunternehmen mit gemischtem Gebäudebestand steht vor der Herausforderung, sein gesamtes Gebäudeportfolio bis 2045 auf einen möglichst CO2-armen Betrieb auszurichten. Gleichzeitig sollen die Betriebskosten langfristig stabil und planbar bleiben. Die Gebäude unterscheiden sich nicht nur in ihrem Alter, sondern auch der energetische Zustand variiert stark – vom teilmodernisierten Nachkriegsbau bis zur hochmodernen Wohnanlage. Laufende Mietverhältnisse und wirtschaftliche Zwänge sind bei der Umsetzung zu berücksichtigen.
Einzelmaßnahmen, wie der Austausch alter Leuchten gegen LED-Modelle, Rohrleitungsdämmungen und der Einsatz digitaler Thermostate sind bereits erfolgt. Damit ist der Punkt erreicht, an dem das Wohnungsunternehmen ein ganzheitliches, auf das spezifische Portfolio abgestimmte Konzept auf Basis fundierter Daten, Analysen und Prognosen benötigt.
Der erste Schritt des Dekarbonisierungsaudits ist die Festlegung des Ziels. „Das könnte in diesem Fall eine Reduzierung der CO2-Emssionen über das gesamte Portfolio hinweg von mindestens 80 Prozent bis 2045 sein“, so Stalf.
Für die Bestimmung des Ist-Zustandes werden dann die relevanten Daten zusammengetragen. Auf Basis von Gebäudeplänen und einer Begehung vor Ort wird für jedes Gebäude ein digitaler Zwilling erstellt. Diese virtuellen Abbilder bilden die energetischen Eigenschaften und die Nutzungsszenarien präzise ab.
Eine GAP-Analyse mittels CRREEM (Carbon Risk Real Estate Monitor) zeigt die Lücke zwischen dem aktuellen Emissionspfad und dem Zielpfad und damit die relevanten Handlungsfelder.
„Auf Basis dieser Analyse und der digitalen Zwillinge können wir Sanierungsmaßnahmen für jedes Gebäude simulieren, Einsparpotenziale zuverlässig berechnen und Investitionen vergleichen – und zwar bevor die erste Maßnahme begonnen wird“, erklärt Sebastian Stalf. Bei der Betrachtung der Maßnahmen werden neben den Gebäuden auch die Rahmenbedingungen geprüft, z. B. was die kommunale Wärmeplanung für das Gebiet vorsieht oder ob sich in der Nähe eine nutzbare Abwärmequelle, beispielsweise aus einem Rechenzentrum oder aus Gewerbekälte, befindet.
Als Ergebnis des Audits erhält das Wohnungsunternehmen für jedes Gebäude eine CO2-Bilanz und einen individuellen Maßnahmenfahrplan, der auch eine Priorisierungsliste und eine Zeitachse sowie Investitionskosten und Amortisationsprognosen enthält. Hier sind auch externe Faktoren berücksichtigt. Dazu zählen Fördermöglichkeiten, sachkundige Prognosen zur Energiekostenentwicklung sowie regulatorische Anforderungen, etwas aus dem GEG.
Das Wohnungsunternehmen hat damit eine langfristige Planungsgrundlage für gezielte Investitionen in Immobilien, die auch in einer klimaneutralen Zukunft noch attraktiven Wohnraum bieten.
Fazit
Für die Wohnungswirtschaft ist das Dekarbonisierungsaudit ein strategisches Instrument mit doppeltem Nutzen: Es hilft dabei, Klimaziele systematisch zu erreichen und gleichzeitig Investitionen gezielt zu steuern. In einer Branche, in der jede Maßnahme mit Blick auf Wirtschaftlichkeit und soziale Verträglichkeit abgewogen werden muss, bietet das Audit eine verlässliche Entscheidungsgrundlage. So lassen sich komplexe Anforderungen in realistische Schritte überführen – und der Weg zur klimaneutralen Wohnimmobilie wird planbar, bezahlbar und umsetzbar.
Verweise
[1] www.energiewende.bundeswirtschaftsministerium.de/EWD/ Redaktion/Newsletter/2014/32/newsletter_2014-32.html
[2] Studie zum 13. Wohnungsbautag 2022 und Ergebnisse aus aktuellen Untersuchungen Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen e.V., www.gdw.de/media/2022/02/studie-wohnungsbau-tag-2022-zukunft-des-bestandes.pdf